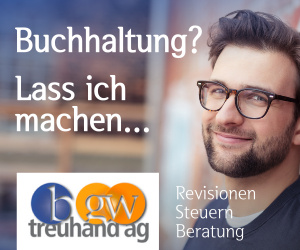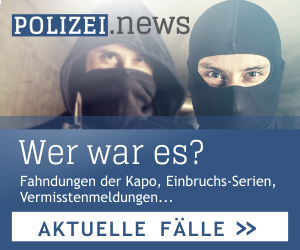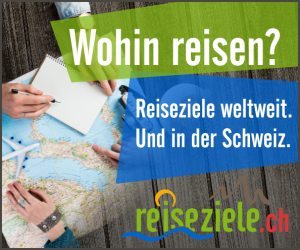Waagen: den Alltagshelfern ins technische Herz geschaut
VON Christian Praetorius Allgemein
Die Masse direkt zu bestimmen, ist jedoch mit handelsüblichen Geräten unmöglich. Eine Waage ist deshalb per Definition ein Messgerät, das zur Bestimmung der Masse des Wiegegutes verwendet wird, indem dessen Gewichtskraft gemessen wird. In Haushalt und Betrieb finden sich Waagen in vielen Bereichen, von der Küchenwaage über die Briefwaage im Büro bis zur Schwerlastbodenwaage für Paletten oder ganze LKW.
Trotz der Unterschiede in Messbereich und Skalierung sind die zugrundeliegenden physikalischen Prinzipien immer die gleichen: Entweder wird das Gewicht direkt gemessen oder im Vergleich mit einem standardisierten Referenzgewicht ermittelt.
Vom alten und neuen Ur-Kilogramm
Die Einheit der Masse ist das Kilogramm und wie der Meter hat auch das Kilogramm einen Prototypen. Dieses „Urkilogramm“ ist ein Zylinder aus Platin-Iridium, das in Sèvres bei Paris im Bureau International des Poids et Mesures verwahrt wird, seit 1889. Allerdings arbeiten Wissenschaftler seit 2003 daran, die Einheit Kilogramm wissenschaftlich exakter auf Grundlage von atomaren Eigenschaften neu zu definieren. Dieses wird jedoch kaum Auswirkungen auf die Praxis haben, sondern dient vor allem der Wissenschaft.
Gewicht und Gewichtskraft
Was im Allgemeinen als „Gewicht“ bezeichnet wird, ist physikalisch korrekt die Masse eines Körpers, die mit der vorhandenen Erdbeschleunigung eine Kraft, die Gewichtskraft, entwickelt. Diese Kraft kann gemessen und in Gramm, Kilogramm oder Tonnen quantifiziert werden. Am einfachsten geht das mit einer Schraubenfeder, an die das Wiegegut gehängt wird. Die Feder dehnt sich und legt eine bestimmte Strecke zurück, bis sich die Gewichtskraft des Wiegegutes und die Federkraft im Gleichgewicht befinden und gegenseitig ausgleichen.
Auf der Skala auf der Federwaage kann dann das Gewicht abgelesen werden. Allerdings muss bei dieser Art der Gewichtsermittlung der Ortsfaktor berücksichtigt werden, denn die Schwerkraft wirkt nicht überall auf der Erde gleich stark, was das Messergebnis beeinflusst. Diese Abweichungen sind jedoch relativ gering (sie liegen bei unter einem Prozent) und werden daher in der Regel vernachlässigt oder durch geeignete technische Massnahmen bei besonders genauen Waagen ausgeglichen.
Nicht nur mit einer Feder kann die Gewichtskraft eines Körpers ermittelt werden, auch Membranen und Kraftsensoren werden in modernen Wiegesystemen eingesetzt, ebenso werden physikalische
Phänomene wie der Piezoeffekt oder Ringtorsion genutzt. Die eingesetzte Technik bestimmt dabei auch die Wiegegenauigkeit und den Wiegebereich – Waagen mit diesem Messprinzip sind etwa Personen- oder Küchenwaagen mit einer Genauigkeit von 1-2 Prozent und ebenso Mikro- und Präzisionswaagen, deren Abweichungstoleranz bei nur 0,1 Prozent liegt – und das bei Messbereichen von deutlich weniger als einem Milligramm.
Massenvergleich statt Gewichtskraft
Die zweite Möglichkeit, das Gewicht eines Körpers zu messen, ist der Massenvergleich. Dabei wird mit Referenzgewichten zur Messung gearbeitet. Der bekannteste Vertreter dieser Wägetechnik ist die klassische Balkenwaage mit zwei Waagschalen. Auf die eine Waagschale kommt das Gut , dessen Gewicht ermittelt werden soll, durch dessen Gewichtskraft gerät die Waage aus dem Gleichgewicht. Mit standardisierten Referenzgewichten kann dann auf der anderen Waagschale ausgeglichen werden, und zwar solange, bis die Waage sich wieder vollständig austariert im Gleichgewicht befindet. Dann lässt sich an der Summe der Referenzgewichte das Gewicht des Wiegegutes ablesen.
Waagen, die den Massenvergleich nutzen, sind unabhängig vom Ortsfaktor und können daher auch auf anderen Himmelskörpern wie Mond oder Mars verwendet werden. Dieser Vorteil ist in der Praxis eher zu vernachlässigen, dennoch finden sich Waagen mit dieser Messmethode auch im Betrieb: Etwa bei der klassischen Briefwaage, die mit einem festen Gewicht, das sich an einem Hebelarm befindet, arbeitet und dessen Auslenkung misst. Aber auch in grösseren Dimensionen werden Waagen mit dieser Technik realisiert, etwa Strassenbrückenwaagen für LKW, Kranwaagen oder Palettenwaagen.
Elektromechanische und elektronische Waagen
Heute werden allerdings nur noch selten rein mechanische Waagen eingesetzt, in der Regel finden heute elektromechanische oder vollständig elektronische Waagen Verwendung im Betrieb. Sie bieten zahlreiche Vorteile im Vergleich zu mechanischen Modellen, so sind sie genauer, liefern das Wiegeergebnis schneller und sind zudem robuster. So kann eine Elektrowaage im Kilogrammbereich mit einer Empfindlichkeit von ca. 0,1 mg messen und damit deutlich exaktere Ergebnisse liefern.
Das Arbeitsprinzip elektrischer Waagen basiert auf der Umformung der Gewichtskraft, entweder als Verformung oder als zurückgelegter Weg. Realisiert wird dieses durch eine Feder oder einen Biegebalken – wenngleich dieses je nach Dimensionierung der Waage auch ein massiver Metallblock sein kann, der in einer Kranwaage mit einer Tragkraft von mehreren Tonnen eingesetzt wird.
Die Verformung von Feder oder Biegebalken kann entweder direkt gemessen werden, indem ein Dehnungsmessstreifen verwendet wird. Technisch anspruchsvoller ist die indirekte Wegmessung, die sich beispielsweise bei einer Veränderung des Messplattenabstandes über die Kapazitätsänderung in einem Kondensator realisieren lässt. Erstgenanntes Prinzip wird häufig in Wägezellen eingesetzt, während etwa das Prinzip der elektromagnetischen Kraftkompensation verwendet wird, wenn es auf höchste Messgenauigkeiten und Gewichte im Milli- oder Mikrogrammbereich ankommt.
Wiegen statt zählen – Zeitersparnis in der Logistik
Zählwaagen beschleunigen und erleichtern viele Abläufe in der Logistik und der Verpackung. Von einer Referenzmenge eines Artikels wird das Gesamtgewicht bestimmt, die Waage rechnet dann das zusätzliche Gewicht von weiteren gleichartigen Artikeln direkt in Stückzahlen um. Die Waage zählt also anhand des referenzierten Gewichtes und macht damit die Abfüllung von Massenstückgütern schneller und wirtschaftlicher.
Auch bei der Inventur werden Zählwaagen häufig eingesetzt, um lose Artikel nicht auszählen zu müssen und so schneller ein Zählergebnis zu erhalten. Allerdings setzt diese Technik voraus, dass die Kalibrierung der Waage sorgfältig und korrekt geschieht. Bei kleinen und leichten Artikeln muss eine ausreichend grosse Referenzmenge ausgezählt werden, um mögliche Gewichtsunterschiede der einzelnen Teile auszugleichen. Je grösser die Referenzmenge gewählt wird, desto genauer wird das Wiegeergebnis, sofern die manuelle Zählung korrekt war. Zählwaagen bieten daher meistens eine Bandbreite von 10 und 100 Teilen, die als Referenzmenge genutzt werden können.
Brutto, Netto und Tara
Das Nettogewicht ist das eigentliche Gewicht des Wiegegutes, also des Artikels. Wird dieser verpackt und palettiert, ist nicht mehr das Nettogewicht des Artikels, sondern das Bruttogewicht des Packstückes die relevante Grösse, etwa für die Spedition. Die Differenz von Brutto- und Nettogewicht ist das Tara oder Taragewicht – in diesem Fall also das Gewicht des Verpackungsmaterials und der verwendeten Palette. Bei der Zollabfertigung wird in der Schweiz etwa ein Tarazuschlag erhoben, der auf das Gewicht von unverpackter Ware (Schüttgüter) aufgeschlagen wird, dieser ist in der Taraverordnung aus dem Jahr 1987 geregelt.
Selbst wenn moderne Waagen und Wiegetechnik heute oftmals mit (Mikro-)Elektronik arbeiten, an den physikalischen Grundlagen des Wiegens hat sich nichts verändert. Die Technik sorgt für bessere, schnellere und genauere Ergebnisse, erhöht den Komfort oder beschleunigt Arbeitsprozesse wie es Zählwaagen tun.
Oberstes Bild: In Haushalt und Betrieb finden sich Waagen in vielen Bereichen. (Torsak Thammachote / Shutterstock.com)